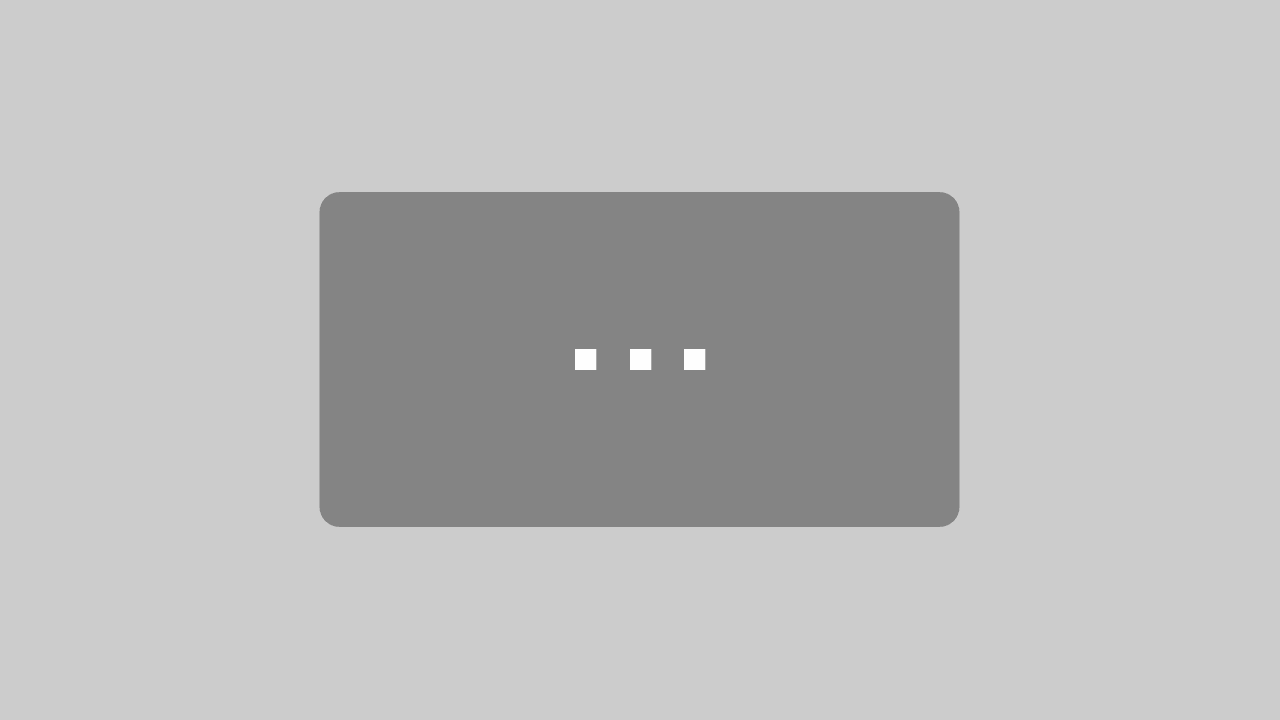Die Preise für Lebensmittel, Kleidung und viele weitere Konsumgüter steigen in der Schweiz wie seit Jahren nicht. Besonders bei Erdölprodukten, Gas oder Automobilen ist die hohe Teuerungsrate spürbar. Durch die gestiegenen Nebenkosten muss inzwischen auch für das Wohnen mehr Geld aufgebracht werden.
Der Begriff Inflation ist in aller Munde. Daher ist es sinnvoll, über die weitreichende Bedeutung der Inflation informiert zu sein. Welche volkswirtschaftlichen Auswirkungen hat die Inflation und wie steht die Schweiz im internationalen Vergleich dar? Gut informiert fällt es leichter, als privater Verbraucher darauf besonnen und geschickt zu reagieren.
Contents
- 1 Das Wichtigste in Kürze
- 2 Inflation einfach erklärt
- 3 Die Inflation in der Schweiz im weltweiten Vergleich
- 4 Welche Faktoren beeinflussen die Inflation?
- 5 Auswirkungen der Inflation aus Sicht der Sparer und Investoren
- 5.1 Die Auswirkungen der Inflation auf Sparguthaben
- 5.2 Die Auswirkungen der Inflation auf Kredite
- 5.3 Strategien für den Umgang mit der Inflation
- 5.4 Die Auswirkungen der Inflation auf die Obligationskurse
- 5.5 Die Auswirkungen der Inflation auf die Aktienkurse
- 5.6 Die Auswirkungen der Inflation auf den Immobilienmarkt
- 6 Wie kann ich mein Vermögen am besten vor einer hohen Inflation schützen?
- 7 Die historische Entwicklung der Inflation in der Schweiz
- 8 Häufige Fragen (FAQ)
- 8.1 Kann die Inflation auf einzelne Bereiche separat betrachtet werden?
- 8.2 Welche Möglichkeiten hat der Staat, um auf die Inflation zu reagieren?
- 8.3 Was bedeutet «versteckte Inflation»?
- 8.4 Was ist unter Deflation und Stagnation zu verstehen?
- 8.5 Warum hat eine Deflation gravierendere Folgen als eine Inflation?
Das Wichtigste in Kürze
- Inflation bezeichnet die allgemeine Teuerungsrate.
- Die Schweiz hat die höchste Inflationsrate seit 14 Jahren und international trotzdem eine der niedrigsten.
- Anleger können durch Anpassung der Anlagestrategie Verluste vermeiden.
- Eine niedrige aber konstante Inflationsrate um die 2 Prozent, ist gesund für die Wirtschaft
Inflation einfach erklärt
Inflation ist ein wirtschaftlicher Begriff, der einen anhaltenden Anstieg des allgemeinen Preisniveaus für Waren und Dienstleistungen in einer Volkswirtschaft über einen bestimmten Zeitraum hinweg beschreibt.
Sie wird in der Schweiz durch den Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) festgestellt. Der Index basiert auf die Entwicklung der Preise in den zwölf wesentlichen Ausgabenkategorien der Schweizer Haushalte. Die monatliche Aktualisierung wird aufgrund der Preise eines Referenzjahres erstellt.
Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für den internationalen Vergleich
Seit 2008 veröffentlicht das Schweizer Bundesamt für Statistik den harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) nach den Kriterien der Europäischen Union. Dieser HVPI ist ein wichtiger Bestandteil des LIK und wird für den Vergleich der Inflationsraten in den EU-Ländern, Norwegen und Island verwendet.
Inflation als Bestandteil der Wirtschaftspolitik
Kurzfristig kann die Erhöhung der Geldmenge und damit eine Steigerung der Inflation ein wirkungsvolles Mittel sein, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen steigt, da die Kaufkraft der Menschen zunächst erhöht wird. Langfristig ist eine zu hohe Inflation jedoch schädlich, da das Realeinkommen durch die Teuerung wieder abnimmt. Durch die dann im Verlauf wieder sinkende Nachfrage sind die Unternehmen gezwungen, Kosten zu sparen. Dies geht oft einher mit einer höheren Arbeitslosenquote.
Die Folgen der Inflation für Konsumenten
Als Verbraucher erleben Sie durch die Inflation insbesondere folgende negative Auswirkung: Sie können für dieselbe Menge Geld weniger konsumieren. Nehmen wir als praktisches Beispiel eine Torte vom Konditor, die früher dreissig Franken kostete und heute sechzig Franken. Das bedeutet, dass der Franken in dem Fall die Hälfte an Kaufkraft verloren hat. Andere Begriffe dafür sind Geldentwertung oder Kaufkraftminderung.
Oft wird durch Inflation auch das Gefühl vermittelt, dass etwas teurer geworden ist, was als «gefühlte Inflation» bezeichnet wird. Schliesslich ist es nicht immer leicht, den Überblick zu behalten, welche Produkte oder Leistungen betroffen sind und welche prozentuale Steigerung stattgefunden hat.
Ebenso hat die Inflation Auswirkungen auf Ihre Anlagestrategie sowie Ihre Altersvorsorge. Denn mit einer Rendite unterhalb der Inflationsrate, wird Ihr Altersguthaben faktisch entwertet statt gesteigert.
Leichte Inflation ist volkswirtschaftlich gesund und daher gewünscht
Die Inflation hat erhebliche Auswirkungen auf den Arbeitssektor eines Landes, die Einkommens- und Vermögensverteilung und die wirtschaftliche Entwicklung. Wenn die Inflation gering ist und zwischen null und zwei Prozent liegt, regt sie die Nachfrage an, da die Käufer mit ihrem Geld kaufen oder investieren wollen. Wenn die Inflation jedoch hoch ist, verliert das Geld schneller an Wert als die Waren, was zu einem Rückgang der Reallöhne führt. Die Inhaber von Sparkonten sowie festverzinslichen Wertpapieren wie Obligationen sind auf der Verliererseite, da ihre Vermögenswerte weniger wert sind. Zunächst profitiert der Staat in gewissem Masse, da der Realwert seiner Schulden sinkt.

Die Inflation in der Schweiz im weltweiten Vergleich
Viele Experten gehen davon aus, dass die Indikatoren sowohl in Europa als auch in der Schweiz eine Wende anzeigen und eine stärkere Preisstabilität zu erwarten sei. Dabei steht die Schweiz mit 2.8 Prozent Jahresteuerung recht gut dar. Die Teuerung lag bei Inlandsgütern sogar nur bei 1.9 Prozent. Es handelt sich also zu einem erheblichen Teil um eine importierte Teuerung durch die im Ausland gestiegenen Preise.
Für Deutschland ist aktuell zu berücksichtigen, dass die gesunkene Inflationsrate im Dezember ausschliesslich auf die gesunkenen Energiepreise zurückzuführen ist. Dies kam allerdings dadurch zustande, dass der Staat in diesem Monat die Abschlagszahlungen für die Gaslieferung übernommen hat.
Inflationsraten international
Um die Inflation in der Schweiz sowie im Euroraum besser einordnen zu können, nachstehend die Inflationsraten einiger ausgesuchter Länder (Jahresbasis, Stand 02.02.2023):
- Türkei: 64.27 Prozent
- Grossbritannien: 10.51 Prozent
- Deutschland: 9.91 Prozent
- Eurozone: 9.19 Prozent
- USA: 6.45 Prozent
- Schweiz: 2.84 Prozent
Bei den Jahreszahlen ist zu beachten, dass aktuell in den Ländern Deutschland, USA und der Schweiz die Inflation rückläufig ist. Dies trifft ebenso auf die durchschnittliche Inflationsrate in der Eurozone zu.
Krise in der Türkei begann nach der Zinssenkung
Ökonomen führen die explodierende Inflation in der Türkei auf die extrem lockere Geldpolitik der türkischen Notenbank zurück. Die Probleme für das Land verschärften sich zunehmend, seit den Zinssenkungen im September 2021. Bei hoher Inflation sollten die Notenbanken eigentlich mit höheren Zinsen entgegensteuern, jedoch wird dies in der Türkei aus politischen Gründen nicht gemacht. Die türkische Lira hat stark an Wert eingebüsst, was die Importe verteuerte – insbesondere im Bereich Energie und Rohstoffe.
Niedrige Inflationsrate in der Schweiz – warum?
Wenn auch die Teuerungsrate den höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht hat, träumen viele Europäer von einer solch niedrigen Inflation.
Die wichtigsten Gründe dafür sind:
- Die Schweiz hat eine starke Währung: Wertet der Franken auf, verbilligt dies für die Verbraucher die importierten Güter.
- Schweizer Nahrungsmittelpreise vom Weltmarkt abgekoppelt: Durch Importzölle auf ausländische Agrarprodukte, die ebenso in der Schweiz hergestellt werden, werden die Schweizer Gemüsebauern vor dem Ausland geschützt. Lediglich bei schlechter Ernte im Inland werden die Zölle vorübergehend gesenkt, um die Versorgung sicherzustellen.
- Strombedarf wird überwiegend aus Wasserkraft und Atomkraft gedeckt: Lediglich im Winter muss die Schweiz weiteren Strom aus dem Ausland importieren.
- Zinsniveau: Die Schweizer Nationalbank (SNB) verhindert durch ein vergleichsweise niedriges Zinsniveau, dass die Kapitalzuflüsse über den Kapitalabflüssen liegen und dämpft dadurch den Inflationsdruck.
- Niedrige Staatsverschuldung: Die Staatsverschuldung liegt, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, im Euroraum 2021 bei etwa 95 Prozent. In der Schweiz betrug sie lediglich 42 Prozent. Das mindert den Druck auf die Zentralbank, die Geldmenge zu erhöhen, um die Zinsen niedrig zu halten.
- Stabiles Wirtschafts- und Bankensystem: Die Schweiz ist als kleines Land einem starken Wettbewerb durch die umliegenden Länder ausgesetzt. Das hat seit jeher die Innovationskraft getrieben. Ebenso zahlt sich die gemässigte Lohn-Preis-Spirale derzeit aus.

Welche Faktoren beeinflussen die Inflation?
Es ist nicht allein ein Faktor, der für den Anstieg der Inflation verantwortlich zeichnet, vielmehr ist es häufig eine Kombination aus verschiedenen Umständen.
Folgende Faktoren tragen zu einer erhöhten Inflation bei:
- Geldmenge: Wird die Geldmenge, also das im Umlauf befindliche Geld, im Vergleich zur Produktionsrate stärker erhöht, führt dies zur Inflation durch einen Nachfragesog. In dem Fall stehen zu viele Franken für zu wenige Produkte bereit.
- Nachfrage: Ist die Nachfrage nach bestimmten Produkten grösser als das Angebot, kommt es zu erhöhten Preissteigerungen.
- Kosten: Steigen die Lohnkosten und Materialkosten (beispielsweise für Baumaterialien), werden diese Kostensteigerungen an die Verbraucher weitergegeben.
- Abwertung: Wird die eigene Währung abgewertet, verbilligt dies die Exporte. Gleichzeitig werden jedoch ausländische Produkte im Land teurer, was die Inflation steigen lässt.
- Lohnsteigerungen: Steigen die Löhne zu stark, wirkt sich dies durch hohe Kostensteigerungen am Ende auf die Produkte aus. Hier wird auch von der Lohn-Preis-Spirale gesprochen.
- Politische Massnahmen: Auch politische Massnahmen können die Inflation anregen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn Steuersubventionen bei bestimmten Produkten eine extreme Nachfrage auslösen und bei einem knappen Angebot dadurch die Preise steigen.
Hintergründe zur aktuellen Situation
Im Euroraum entstand mit Beginn der Coronakrise eine verstärkte Nachfrage bei klassischen Konsumgütern wie Mehl, Nudel oder Toilettenpapier. Nachdem die Lagerbestände des Handels abgebaut waren, stockte die Lieferung verschiedener Rohstoffe wie Holz oder Metall. Die Produktion wurde somit teurer. Gleichzeitig wurde die Niedrigzinspolitik massiv fortgesetzt, um die Wirtschaft in der schwierigen Phase des Lockdowns zu stützen. Die Geldmenge wurde also deutlich erhöht.
Im Frühjahr 2022 führte der Ukraine-Krieg aus zwei Gründen zu einer weiteren Beschleunigung der Inflation:
- Die Ertragsausfälle, die durch die Landwirtschaft der Ukraine verursacht wurden, führten zu einer Verknappung von Nahrungsmitteln auf der ganzen Welt.
- Weiterhin führten die Gasembargos gegen Russland zu gestiegenen Energiekosten, wodurch sich die Produktionskosten erhöhten.
Lesetipp: Prognose Kryptowährungen: Ist das Risiko kalkulierbar?

Auswirkungen der Inflation aus Sicht der Sparer und Investoren
Die Inflation hat Einfluss auf den Wert des Geldes, indem sie die Kaufkraft verringert, und sollte daher Auswirkungen auf die finanziellen Entscheidungen von Sparern und Anlegern haben.
Die Auswirkungen der Inflation auf Sparguthaben
Wer sich für Sparkonten und Festgeldanlagen entscheidet, muss bei einer hohen Inflation niedrige Zinssätze von weniger als einem Prozent hinnehmen, sofern überhaupt noch Zinsen gezahlt werden. Das bedeutet, dass selbst die günstigsten Bankangebote kaum einen realen Wert haben.
Beispiel: Von einem Startguthaben von 50’000 Franken bleiben nach zwei Jahren bei einer Inflationsrate von drei Prozent nur noch rund 47’000 Franken an realer Kaufkraft übrig, wenn Ihr Geld unverzinst auf Konten liegt. Die Auswirkungen der Inflation werden oft übersehen, weil meistens nur auf die nominalen Zahlen geachtet wird.
In der Regel beschliessen die Zentralbanken Leitzinserhöhungen, um der Inflation zu begegnen. Jedoch werden diese Leitzinserhöhungen von den Geschäftsbanken oft nicht in der Höhe und auch zeitlich verzögert an die Konsumenten weitergegeben. Dies kann zu einem negativen Realzins führen. Diese Situation sehen wir aktuell.
Die Auswirkungen der Inflation auf Kredite
Die Inflation führt dazu, dass Schulden an Wert verlieren, genauso wie Vermögen an Wert verliert. Aus diesem Grund sind vor allem Schuldner mit langfristig fixierten Zinssätzen die Gewinner einer Inflation. Neue Kreditnehmer haben jedoch oft höhere Finanzierungskosten durch den Effekt des erhöhten Zinsniveaus zur Bekämpfung der Inflation.
Strategien für den Umgang mit der Inflation
Für Sparer und Anleger ist es wichtig, ihr Geld so anzulegen, dass sie eine Rendite erzielen, die über der Inflationsrate liegt. Es gibt eine Vielzahl von Finanzanlagen, die die Inflationsrate übertreffen, darunter Aktien und Sachwerte. Diese Anlagen bieten nicht nur eine höhere Rendite, sondern auch einen gewissen Schutz, wenn die Preise für Waren und Dienstleistungen explodieren.
Die Auswirkungen der Inflation auf die Obligationskurse
Wie bereits bei den Ursachen zu erkennen war, geht einer steigenden Inflation häufig die massive Erhöhung der Geldmenge voraus. Das bedeutet, die Zinsen fallen immer weiter. Das bedeutet für Anleihen, neu emittierte Anleihen werden mit einem niedrigeren Zins ausgestattet. Indes werden dadurch die bestehenden Anleihen interessanter, da sie noch eine höhere Verzinsung bieten. Daher steigen die Kurse an den Börsen.
Hier dürfen Anleger allerdings die Zinswende nicht verpassen. Steigen die Zinsen wieder, so fallen die Kurse der vermeintlich sicheren Anleihen. Hier ist es auch von Relevanz, ob es sich um Obligationen mit fixen oder variablen Kuponzahlungen handelt.
Die Auswirkungen der Inflation auf die Aktienkurse
Auch in Zeiten der Inflation können Sie mit Ihrem Vermögen möglicherweise sogar Gewinne erzielen, wenn Sie die richtigen Fonds und Aktien aussuchen. Wer sich für einen wertstabilen Bereich entscheidet, kann sein Geld vor dem Verlust durch Inflation schützen. Es ist allerdings wichtig, zu wissen, dass nicht alle Arten von Sachwerten einen Schutz vor Inflation bieten.
In Zeiten steigender Inflation haben sich etwa Aktien für Konsumgüter gut entwickelt. Diese Unternehmen sind eher in der Lage, die gestiegenen Preise an die Verbraucher weiterzugeben. Eher schlecht entwickeln sich Werte auf zyklische Güter wie zum Beispiel Autos. In diesen Branchen macht sich der sinkende Konsum durch höhere Zinsen als erstes bemerkbar.
Lesetipp: Säule 3a-Fonds: Tipps, Renditechancen
Die Auswirkungen der Inflation auf den Immobilienmarkt
Seit 1998 haben sich die Immobilienpreise in der Schweiz nahezu verdoppelt. Der Markt wurde vor allem durch die niedrigen Zinsen für Hypotheken zusätzlich angeheizt. Die Geldanlage in eine Immobilie wurde so für viele erschwinglich, da sich die Zinsen für Hypotheken auf einem historischen Tief bewegten.
Inzwischen sprechen allerdings viele Experten davon, dass der Zenit am Immobilienmarkt erreicht ist. Seitdem die Zinsen wieder ansteigen, hat die Nachfrage nach Immobilien nachgelassen. Schliesslich macht sich eine Zinsdifferenz von zwei Prozent bei einer Hypothek über 200’000 Franken mit einer zusätzlichen monatlichen Belastung von über 330 Franken bemerkbar.
Trotzdem steht ein Investment in Immobilien vor allem für Sicherheit und mit einem massiven Einbruch ist daher nicht zu rechnen. Nach wie vor ist somit die Immobilie ein wesentlicher Baustein innerhalb einer ausgewogenen Anlagestrategie. Als Anleger sollten Sie allerdings bei reinen Renditeimmobilien inzwischen vorsichtiger sein da vor allem die Kosten steigen. In der Regel bewegen sich die Werte für Immobilien aber mit der Inflation mit.
Wie kann ich mein Vermögen am besten vor einer hohen Inflation schützen?
Wie bereits bei den einzelnen Segmenten zu erkennen, sind lediglich bei Sachwerten noch Renditen möglich, die oberhalb der Inflationsrate liegen. Der Vorteil von Sachanlagen ist, dass sie nicht komplett wertlos werden können.
Trotzdem sollten Anleger auf ihre sichere Reserve in Form von Sparkonten oder Tagesgeldkonten nicht verzichten. Damit sind Sie nicht nur auf kurzfristig notwendige Anschaffungen vorbereitet, sondern können bei günstigen Gelegenheiten flexibel am Aktienmarkt einsteigen.
Als Schutz vor einer hohen Inflation bieten sich daher insbesondere folgende Anlagen an:
- Aktienfonds: Das Risiko ist bei einem Anlagehorizont ab zehn Jahren überschaubar. Am besten eignen sich breit gestreute und weltweit anlegende Fonds sowie ETFs.
- Immobilien: Das eigene Zuhause gehört zu einem sicheren und beliebten Baustein der Vermögensanlage. Die Sicherheit ist dabei immer auch von der Art der Finanzierung geprägt. Am besten kalkulieren können Sie daher, wenn Sie sich niedrige Zinsen für eine Hypothek langfristig sichern. Ferner ist eine Immobilie zur reinen Kapitalanlage nur dann ratsam, wenn bereits eine gut aufgestellte Geldanlage vorhanden ist.
- Edelmetalle: Besonders in Krisenzeiten ist Gold eine beliebte Anlage. Edelmetalle stellen tatsächlich einen realen Wert dar, der niemals verfallen wird. Beachten Sie dabei, dass bei Edelmetallen langfristig kaum mit Renditen zu rechnen ist. Daher ist lediglich eine Beimischung zu empfehlen.
- Inflationsindexierte Obligationen: Es gibt Obligationen, deren Kuponhöhe an einen Verbraucherpreisindex geknüpft ist. So steigen die Kuponzahlungen mit der Inflation und bieten einen gewissen Schutz dagegen.
Lesetipp: Private Finanzplanung – so erreichen Sie Ihre individuellen Ziele

Die historische Entwicklung der Inflation in der Schweiz
Der schweizerische Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) informiert über die Teuerung von Konsumgütern. Dieser Index gibt an, wie stark sich diese Güter im Vergleich zum Vormonat, zum Vorjahr oder zum Vorjahresmonat verteuert haben. Er ist ein bedeutungsvoller Wirtschaftsindikator und wird regelmässig in Politik und Wirtschaft herangezogen.
Nach Zahlen des Bundesamts für Statistik gab es in der Schweiz in den vergangenen Jahren folgende Teuerungen:
- 2022: 2.8 Prozent
- 2021: 0.6 Prozent
- 2020: -0.7 Prozent
- 2019: 0.4 Prozent
- 2018: 0.9 Prozent
- 2017: 0.5 Prozent
Explodierende Inflationsraten in der Schweiz in den 70er-Jahren und im Ersten Weltkrieg – warum?
Eine grosse Inflationsperiode gab es in der Schweiz im Ersten Weltkrieg (1914 – 1918). Ursache waren die enormen Kostensteigerungen für die Landesverteidigung. Der Bund reagierte mit ausserordentlichen Steuererhöhungen und eine zunehmende Verschuldung am Kapitalmarkt. Doch je länger der Krieg dauerte, umso mehr wurde der Geldumlauf erhöht. Die Inflationsrate stieg auf über 20 Prozent. Die Kaufkraft sank, da die Lohnsteigerungen dies nicht auffangen konnten.
Heute ist zwar die Geldmenge ebenfalls ausgedehnt worden, jedoch zur Stabilisierung des Wechselkurses und nicht zur Finanzierung von Staatsausgaben. Somit wird dadurch keine Inflation erzeugt.
Die Inflationsraten in den 70er-Jahren von bis zu zwölf Prozent sind durch die expansive Geldpolitik der USA zu erklären. Durch die fixen Wechselkurse hatte dies weltweite Auswirkungen.
Nachdem sich die Schweiz im Jahr 1973 vom fixen Wechselkurssystem abkoppelte und den Franken aufwertete, gingen die Inflationsraten nach einer gewissen Zeit auf normale Verhältnisse zurück.
Da es auf dem internationalen Parkett kein festes Wechselkurssystem mehr gibt, muss sich die Schweiz nicht um die Übernahme einer Inflation fürchten. Es muss also viel passieren, damit die Schweiz wieder eine solche Inflation erlebt. Und selbst wenn sich die Episoden aus der Vergangenheit wiederholen, würde es einige Jahre dauern, bis ein vergleichbarer Zustand eintritt.
Prognosen gehen von weiter sinkender Inflation in der Schweiz aus
Laut der im Dezember 2022 publizierten Prognose des Schweizer Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO), werden die Verbraucherpreise in der Schweiz im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 2.2 Prozent steigen. Die für 2024 erwartete Inflation beträgt laut dem SECO 1.5 Prozent. Demnach ist der Höhepunkt der Inflation also voraussichtlich überschritten.
Lesetipp: Das 3-Säulen-Prinzip der Schweiz

Häufige Fragen (FAQ)
Kann die Inflation auf einzelne Bereiche separat betrachtet werden?
Wie die Auswertungen des BFS zeigen, resultiert ein erheblicher Teil der Inflation in der Schweiz aus Teuerungen importierter Güter. Auch entwickeln sich Konsumgüter und Energiekosten nicht gleich. Als Verbraucher ist es daher ratsam, seinen «persönlichen Warenkorb» zu betrachten. So wird schnell klar, welche Investition sinnvoll ist und welcher besser aufgeschoben werden sollte, sofern möglich.
Welche Möglichkeiten hat der Staat, um auf die Inflation zu reagieren?
Eine der entscheidenden Massnahmen des Staates ist es, die Zinssätze durch die Zentralbank zu erhöhen, um so die Geldmenge zu verringern. Begleitend werden teilweise Entlastungspakete für die Bürger beschlossen. Für die Wirtschaft können Subventionen beschlossen werden, um eine Kostenerhöhung zu mildern.
Was bedeutet «versteckte Inflation»?
Hierbei liegt bereits eine Inflation vor, die jedoch noch nicht öffentlich erkannt wird. Gründe dafür können etwa staatliche Massnahmen sein, die eine Preiserhöhung zeitweilig verhindern.
Was ist unter Deflation und Stagnation zu verstehen?
Deflation bedeutet in der Volkswirtschaft das Gegenteil von Inflation. Die Preise sinken also signifikant und über einen längeren Zeitraum. Die Ursachen sind ein Überangebot an Gütern und Dienstleistungen. Stagnation ist der Ausdruck für einen wirtschaftlichen Stillstand, wo es also kein Wirtschaftswachstum gibt.
Warum hat eine Deflation gravierendere Folgen als eine Inflation?
Stark sinkende Preise kennzeichnen eine Deflation und bilden eine Ausnahme. Diese Situation ist wesentlich kritischer zu sehen als eine Inflation. Der Grund: Unter diesen Vorzeichen kündigt sich meistens eine volkswirtschaftliche Rezession an, da Unternehmen ihre Kosten nicht mehr decken können und Arbeitslosigkeit zur Folge hätte.
Quellenangaben
- [1] bfs.admin.ch
- [2] srf.ch
- [3] blick.ch
- [4] statista.com
- [5] businessinsider.de
- [6] credit-suisse.com
- [7] dw.com